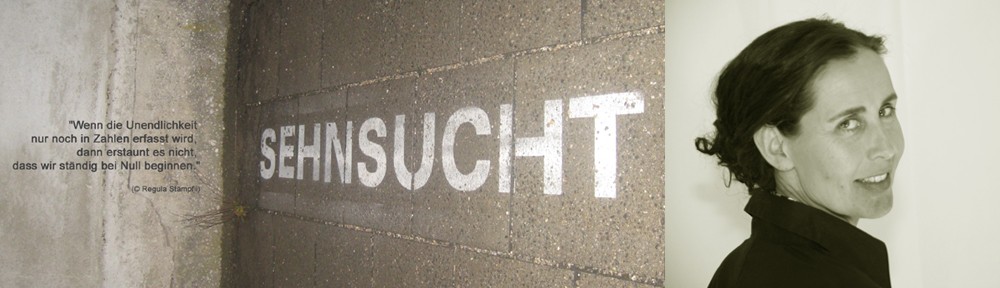Meine Kolumne
Nüshu – die Romantisierung weiblicher Ohnmacht. Kommerzialisierte Selbstermächtigung versus A Room of Her Own
Die Geschichte klingt zu schön, um wahr zu sein. Irgendwo in der chinesischen Provinz, vor Jahrhunderten, schließen sich Frauen zusammen und erfinden eine eigene Schrift. Nur für sie. Geheim. Elegant. Widerständig. Heute, so berichtet der Stern und zahllose Lifestyle-Portale, sei diese „geheime Frauenschrift“ wiederentdeckt worden: als Tattoo, als Stickerei, als Empowerment-Trend für junge Chinesinnen.
Doch genau hier liegt das Problem. Was journalistisch als „faszinierende Entdeckung“ verkauft wird, ist in Wahrheit die Romantisierung weiblicher Ohnmacht.
Denn Nüshu entstand nicht aus Luxus, nicht aus Überschwang, nicht aus einem „weiblichen Bedürfnis nach Geheimnis“. Sie entstand aus brutaler Exklusion. Frauen in Hunan durften nicht lesen und schreiben wie Männer. Sie hatten keinen Zugang zur Bildung, keine Möglichkeit, sich in der offiziellen Schriftkultur zu artikulieren. Nüshu war kein romantisches Extra, sondern eine Notlösung: das Resultat struktureller Gewalt.
Westliche Medien – auch der Stern – lieben diese Erzählung. Sie macht aus chinesischen Frauen „mystische Widerstandskünstlerinnen“, aus Unterdrückung eine Art Folklore. Die patriarchalen Strukturen, die diese Schrift erzwangen, verschwinden im bunten Nebel der Exotik. Nüshu wird zum Lifestyle-Accessoire, als hätte es nie reale Tränen, nie reale Verletzungen, nie reale Ohnmacht gegeben. Nüshu war zudem nie allgemein. Es war regional beschränkt, gebunden an den Dialekt von Jiangyong. Die meisten Frauen in China kannten diese Schrift nie. Heute aber wird sie zur „weiblichen Stimme Chinas“ verklärt – ein gefährlicher Kurzschluss, der Millionen Stimmen unsichtbar macht. Die Universalgeschichte der Frauen wird in ein einziges Ornament gepresst.
Und wie immer, wenn weibliche Räume sichtbar werden, sind sie nicht lange frei. Nüshu wird heute musealisiert, touristisch verwertet, als dekoratives „Heritage“ vermarktet. Junge Frauen tätowieren sich die Zeichen auf die Haut, Modefirmen drucken sie auf T-Shirts. Feministisch lässt sich fragen: Wer profitiert ökonomisch von dieser Wiederentdeckung? Die Frauen selbst – oder die Kulturindustrie, die aus ihrer Not ein Spektakel macht? Nüshu ist wichtig, ja. Es zeigt, dass Frauen immer wieder eigene Räume, eigene Codes, eigene Ausdrucksformen finden, wenn man ihnen den Zugang zu den offiziellen verweigert. Es ist ein Beweis weiblicher Kreativität unter Bedingungen struktureller Gewalt. Aber es ist kein Mythos, kein Ornament, kein Geheimnis. Wir müssen Nüshu nicht verklären. Wir müssen es verstehen als Zeugnis einer Welt, in der Frauen nicht zählten. Und wir müssen zugleich sehen, dass sich dieses Muster wiederholt: Bis heute suchen Frauen nach Räumen, in denen ihre Stimmen nicht sofort zum Schweigen gebracht werden. Statt Nüshu als „Trend“ zu feiern, sollten wir es als Mahnung lesen. Eine Mahnung, dass Frauen immer wieder eigene Schriften, eigene Netzwerke, eigene Code erfinden müssen, um sichtbar zu bleiben. Und eine Erinnerung daran, dass wahre Gleichheit nicht erreicht ist, solange Frauen auf der Suche nach Geheimsprachen sind.
Nüshu ist kein Lifestyle. Nüshu ist ein Schrei.