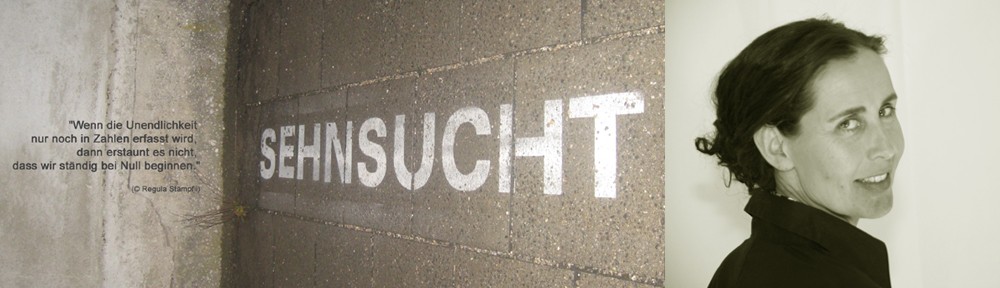Manon Garcia ist die Philosophin der Stunde. Ihre Bücher erscheinen bei Suhrkamp, sie lehrt in Berlin, sie schreibt auf Französisch, wird von der deutschen Presse gefeiert, von der Süddeutschen über die Zeit bis hin zum Spiegel. In Frankreich spielt sie mit Titeln wie Simone de Beauvoir oder Hannah Arendt; in Deutschland bekommt sie einen Suhrkamp-Titel, der klingt wie eine Lifestyle-Broschüre: Mit Männern leben. Really?
Erschien in der Oktober-Ausgabe der Kulturzeitschrift ENSUITE als Essay im Magazin. Bestellen bei: https://www.presseshop.ch/Zeitschriften/Kultur-Zeitschriften-Abos Hier die englische und Französische Übersetzung des Textes. https://regulastaempfli.eu/wp-content/uploads/2025/11/Essay-Regula-Staempfli-on-Manon-Garcia.pdf
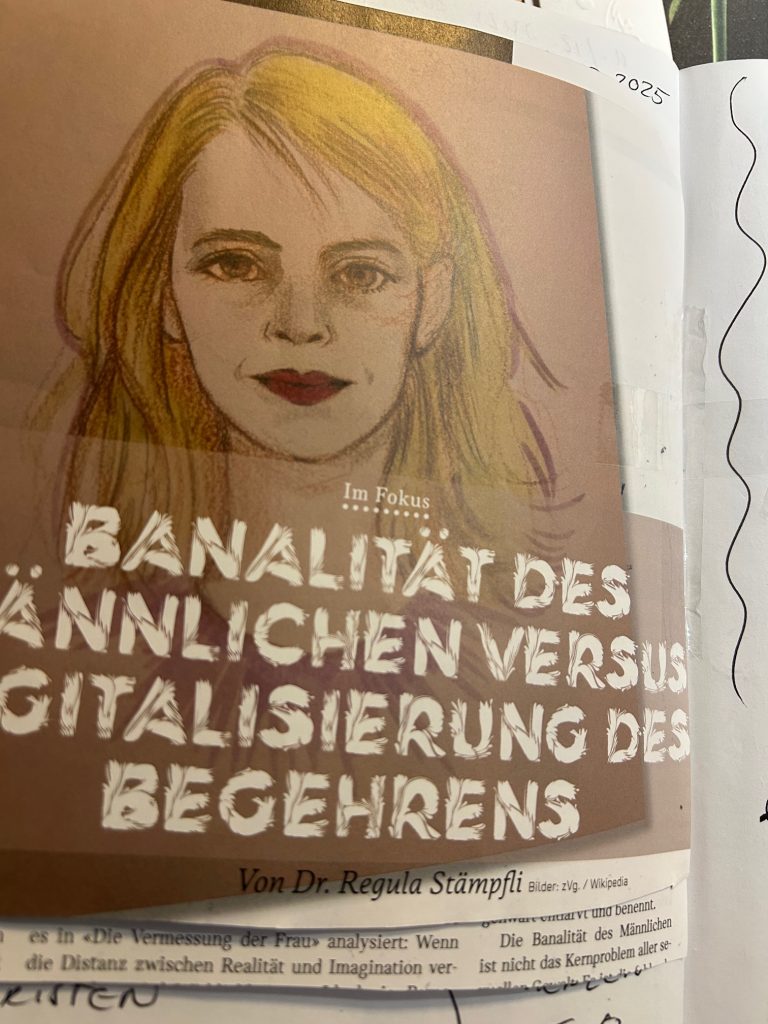
Regula Staempfli im Ensuite über Manon Garcias Buch “Mit Männern leben.”
Hier die Kurzfassung: Banalität des Männlichen versus Digitalisierung des Begehrens
Von Regula Stämpfli
Manon Garcia ist die Philosophin der Stunde. Sie lehrt in Berlin, schreibt auf Französisch, wird von Süddeutscher, Zeit und Spiegel gefeiert. In Frankreich spielt sie mit Simone de Beauvoir und Hannah Arendt, in Deutschland erscheint sie bei Suhrkamp – mit einem Titel, der klingt wie eine Lifestyle-Broschüre: Mit Männern leben. Really?
Das französische Original ist präziser: La banalité du mâle – ein Wortspiel auf Arendts „Banalität des Bösen“. Doch Garcia verwechselt Philosophie mit Psychologie, Denken mit Marketing. Sie universalisiert Einzelfälle, moralisiert Begehren und erklärt das Monströse zum Normalen.
Ihr neues Buch über Die Banalität des Männlichen kreist um den Fall Gisèle Pelicot – einer Frau, die von ihrem Mann betäubt und von siebzig Nachbarn vergewaltigt wurde. Garcia macht daraus ein Allgemeinbild: Alle Männer potenzielle Täter, jeder heterosexuelle Akt potenziell Gewalt. Damit übernimmt sie die Selbstbeschreibung der Monster – und banalisiert das Böse, anstatt es zu analysieren.
Garcia steht symptomatisch für ein Denken, das Geschichte verdrängt und Politik in Lifestyle verwandelt. Feminismus wird zu „Empowerment“, der Hijab zum Accessoire, Philosophie zum Slogan. Vergessen sind Bewegungen wie Ni putes, ni soumises, die in den 2000er Jahren gegen islamistischen Sexismus kämpften – ein Feminismus, der Freiheit über Identität stellte.
Hannah Arendt unterschied klar zwischen privat und öffentlich. Privat darf Intimität alles sein – Lust, Machtspiele, Unterwerfung. Politik aber bedeutet Öffentlichkeit, Gleichheit, Urteilskraft. Diese Unterscheidung fehlt bei Garcia völlig.
Die eigentliche Banalität heute ist nicht „das Männliche“, sondern der Verlust von Unterscheidungskraft. Codes ersetzen Denken, Algorithmen ersetzen Verantwortung. Die Digitalisierung des Begehrens, die Pornographisierung der Kultur, die Intimisierung der Politik – das sind die wahren Phänomene unserer Zeit.
Pornographie ist längst keine Randkultur mehr, sondern Weltordnung. Sie prägt Sprache, Körperbilder, Erwartungen. Männer lernen Sex über Bildschirme, Frauen vermessen sich selbst nach Codes. Social Media verwandelt Körper in Content, das Selfie in „Porno light“.
Garcias Moralisierung lenkt vom Strukturellen ab. Philosophie darf nicht Empörung auf Autopilot sein, sondern muss die Mechanismen der Macht im digitalen Zeitalter entlarven.
Denn: Die Banalität des Männlichen ist nicht das Problem.
Das Problem ist, dass wir aufgehört haben, zwischen pervers und normal, zwischen Code und Wirklichkeit zu unterscheiden.